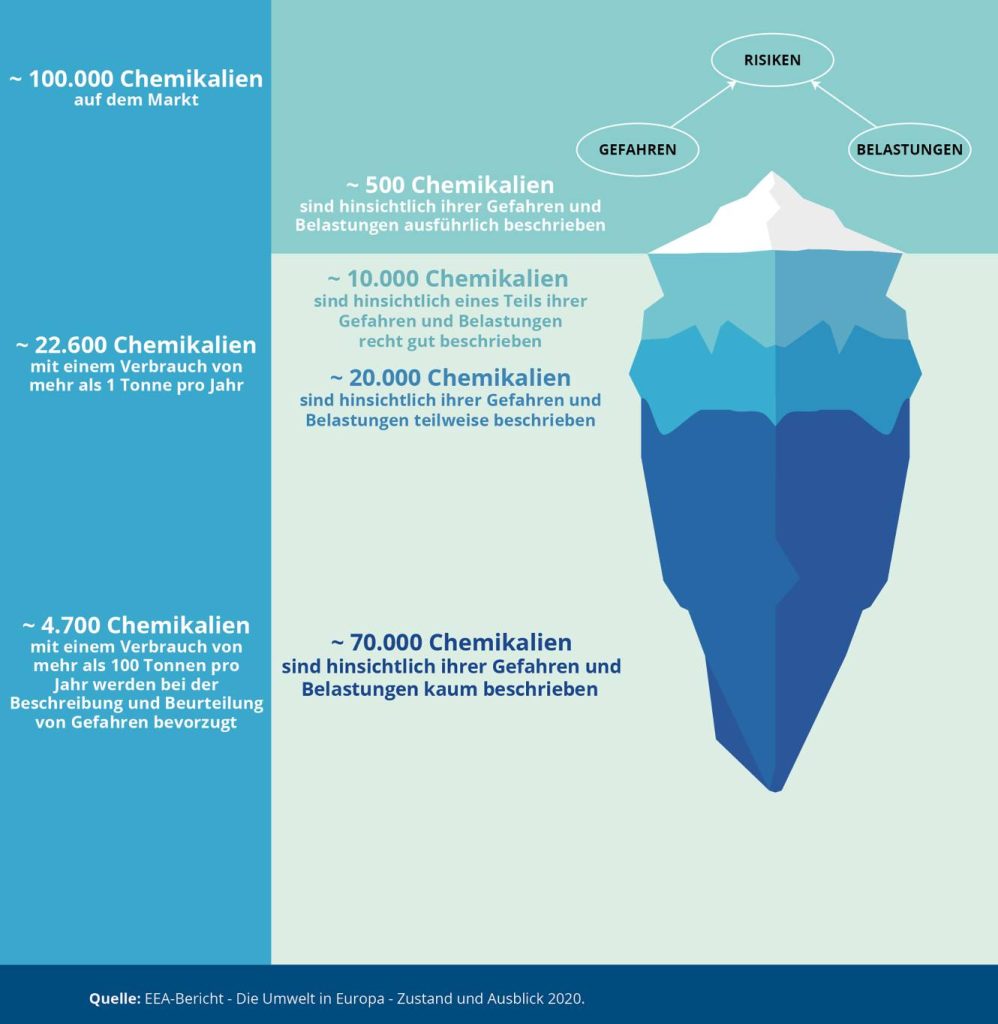Text: Peter Baumgartner
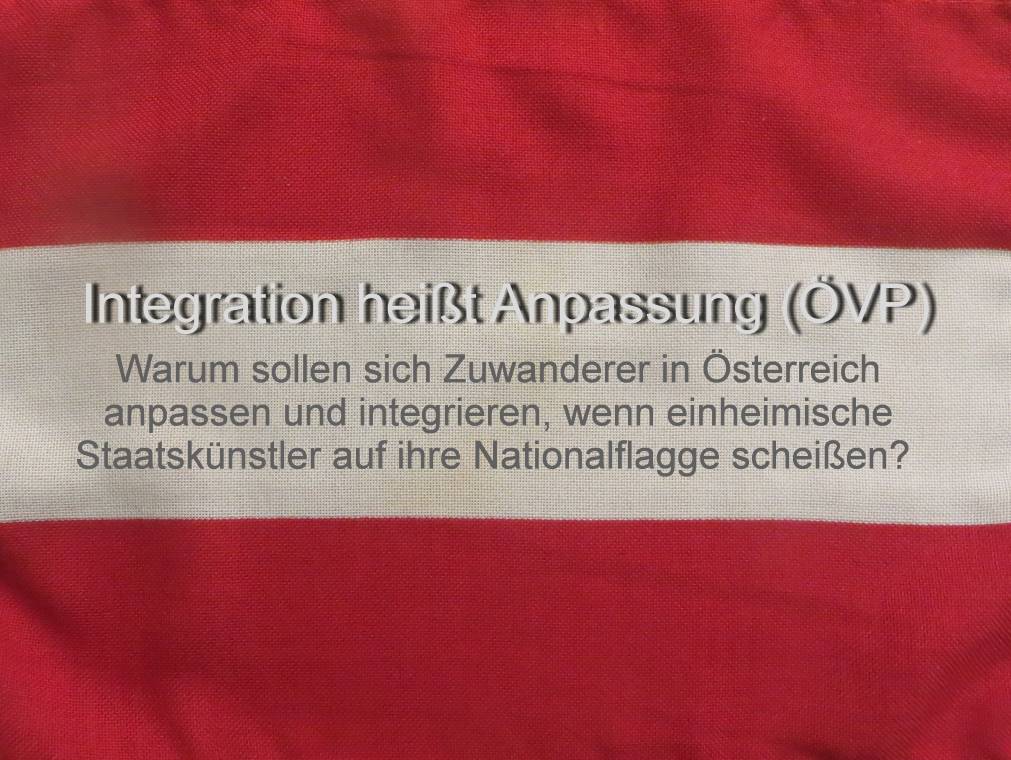
Sollen sich öffentlich-rechtliche Medien als Kunsthändler betätigen und sich in den Kunsthandel einmischen? Oder sollen sich ORF & Co auf ihre Kernaufgaben ausgewogen berichten und unabhängig informieren beschränken?
Der steirische Künstler Günter Brus ist am 10. Februar 2024 gestorben. Sein Tod war für die Medien der zweite Anlass im 85-jährigen Leben des Künstlers, ihn flächendeckend und umfassend zu würdigen. Wobei „würdigen“ im ersten Fall vielleicht das falsche Wort ist. 1968 ging es den Medien nämlich darum, ihn für seine „Ferkelei“ als Nichtstudent in der Uni zu diskreditieren, zu (ver)urteilen und über die strafrechtlichen Folgen für ihn und andere Beteiligte zu berichten. Damals, als „Wiener Aktionist“ schockierte Brus mit seinen Kollegen Otto Mühl & Co die Öffentlichkeit derart, dass er danach vor den Medien und der Inhaftierung ins Ausland flüchten musste. Manche sagen heute, er „ging ins Exil“. Sinngemäß war es wohl eher eine freiwillige und absichtliche Flucht vor der eigenen Verantwortung. Was Brus gemacht hat, zum Beispiel auf die österreichische Flagge zu scheißen, ist übrigens noch immer strafbar (§ 248 StGB) und es ist nicht bekannt, dass sich Brus jemals dafür entschuldigt hätte. Brus hat sich auch nie von einem seiner „Kakademikern“ und schon gar nicht vom Straftäter Otto Mühl distanziert. Dennoch hat ein großherziger Bundespräsident Rudolf Kirchschläger seine Haftstrafe in eine Geldstrafe umgewandelt und so konnte der „Flüchtling“ wieder in seinen gehassten Heimatstaat zurückkehren, wo er fortan nur noch geehrt und hofiert wurde. Das mediale Tam-Tam hat dem Künstler nachträglich betrachtet also nicht geschadet. Im Gegenteil. Sein „Wert“ stieg und verhalf ihm schließlich zu höchsten Ehren in Österreich und in der Steiermark sowieso.
Anders als die Anfänge der künstlerischen Laufbahn, wurde der Tod von Günter Brus tatsächlich zu einer kollektiven Huldigung. Schon am Todestag begann eine mediale Gatekeeper Maschinerie zu laufen, die ein einziges Ziel hatte, nämlich den Wert des Künstlers und seiner Werke zu steigern. An der Spitze der Reichweiten mächtige und öffentlich-rechtliche Rundfunk, der einem „großen Künstler“ nachtrauerte und mehrfach Plattform für alle „Wertschätzungen“ bot. Landsmann und Vizekanzler Kogler erinnerte an einen „großen Geist und Mensch“. Was früher Pfui war und aufgeregt hat, läuft heute unter Chiffre 68er und war nur „provokant“, „aggressiv“ und „anfangs verkannt“. Dabei wollte der Künstler selber seine Aktion nicht als Kunst, sondern als schockieren verstanden wissen. Unbeirrt sprach der Wiener Bürgermeister von einem Künstler, der mit seiner radikalen Körperkunst die Kunstwelt verändert hat. Die Grüne Kunststaatssekretärin will von Brus nur eine „künstlerische Ausnahmeerscheinungen“ wahrgenommen haben. Selbst die kommunistische Bürgermeisterin von Graz, honoriert die „wichtigen Anstöße für gesellschaftliche Veränderungen“, zu denen Brus immer beigetragen hat. Die Direktorin des Dommuseums der Erzdiözese Wien, Johanna Schwanberg, schreibt in der Furche und in der KathPress, dass „eine der konsequentesten und bahnbrechendsten Künstlerpersönlichkeit“ gestorben ist. Man stelle sich vor, was passieren würde, wenn heute ein Zuwanderer im Vorlesungssaal auf die österreichische Flagge scheißt…
Wie bei allen umstrittenen Künstlern, spätestens mit dem Tod, oft schon viel früher, beginnt die „Wertsteigerung“, die von manchen auch als Rehabilitierung wahrgenommen wird. Erst in seltenen, tief gehenden Diskussionen geht es um die Frage, ob man Künstler losgelöst von ihrem Werk sehen kann/soll. Natürlich, sagen die, die von der Kunst profitieren (wollen) und die Fans sowieso. Man beruft sich auf Pragmatismus und aufgeklärte Gesellschaft. Betroffene sehen das allerdings anders und fordern Verantwortung ein – auch von denen, die nach dem Tod eines umstrittenen Künstlers von dessen Arbeit profitieren. Opfern geht es um Transparenz und darum, dass ihr Leiden, ihre Demütigung, ihr Missbrauch, ihr Rechtsempfinden, nicht vergessen oder gar vertuscht wird. „Aus den Augen, aus dem Sinn“ ist für Leidtragende keine Option. Beide Positionen sind schwer in Einklang zu bringen. Ganz egal, um welche Kunstrichtung es sich handelt. Eine Intervention der Opfer hat aber möglicherweise wertmindernde Folgen. Darf zum Beispiel das Aktbild eines minderjährigen Opfers überhaupt „verkauft“ werden? Natürlich wird man diese Frage auch in einem historischen Kontext sehen müssen, aber lebende Opfer kann man wohl kaum ungeniert allein als Kunstwerk betrachten. Und es ist äußerst fraglich, ob sich der „Markt“ allein auf seine Position als „Vermarkter“ zurücklehnen darf. Künstler, egal aus welchem Bereich sie kommen/kamen, von Wagner über Michael Jackson, Handke, Woody Allen, Otto Mühl – oder Günter Brus, sie alle und mit ihnen ihre „Besitzer“ haben eine Verantwortung übernommen und die heißt „Idol“. Menschen neigen dazu, sich an ihrem Idol zu orientieren, ihnen nachzueifern, sie zu kopieren, oder gar nach ihrem Vorbild zu leben. Damit ist für Idole eine große Verantwortung verbunden. Francis Bacon warnt vor der Gefahr, dass Trugbilder die Menschen an adäquaten Erkenntnissen und insbesondere am selbständigen Denken hindern können. Beispiele dafür gibt es genug.

Quelle: Peter Baumgartner
Eine wesentliche Rolle in der Frage, wie mit „kontaminierten“ Künstlern umgegangen werden soll, kommt den Medien zu und hier betrifft es wiederum insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien mit ihrer Breitenwirkung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verflechtungen. Als typisches Beispiel mag der „Fall Teichtmeister“ gelten, dessen umstrittenes Urteil dazu geführt hat, dass der ORF einen „Bann“ über den Ex-Burgschauspieler ausgesprochen hat. In der Diskussion über den Fall ging es aber bereits nur um zwei Fragen: Ist Teichtmeister für immer schuldig, oder gibt es einen Weg zurück ins normale Leben? Es gibt aber noch eine dritte Frage, eine entscheidende und viel wichtigere Frage und das ist der offene Umgang mit einer Verurteilung, die Übernahme der Verantwortung und kein „Schwamm drüber“ nach einer Abkühlphase. Erst daraus kann sich eine Präventivwirkung entwickeln, die letztlich zu einem „nie wieder“ beitragen kann. Teichtmeister hat, im Gegensatz zu Brus, die volle Verantwortung für seine Straftat übernommen. Im Gegensatz zu Günter Brus, der völlig rehabilitiert ist, nahm der ORF „mit sofortiger Wirkung von Herstellung und Ausstrahlung von Produktionen mit Florian Teichtmeister Abstand“. Das ist zunächst gut und Gebot der Stunde. Die Frage ist, wie lange wird die mediale Abstinenz anhalten und was folgt danach? Wird man Teichtmeister wie Brus nach seinem letzten Tag auch nur noch als großen Künstler/Idol, der er zweifelsohne für viele ist, würdigen und mit Preisen überhäufen? Die Vermutung liegt nahe, dass spätestens dann, aber wahrscheinlich schon viel früher, der „Werterhalt“ und die „Vermarktungschancen“ insbesondere für den ORF im Vordergrund stehen werden. Hubert Thurnhofer, Galerist und Präsidentschaftskandidat, meint, es ist keine Kunst ein Bild zu malen, aber es ist Kunst, ein Bild zu verkaufen. Da ist ein echter Gatekeeper tatsächlich von unschätzbarem Wert.