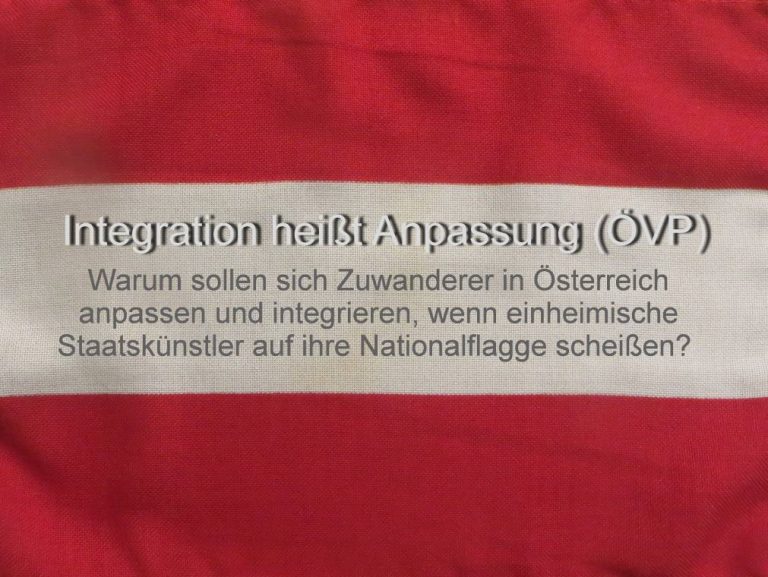Ab durch die Mitte!
Text: Peter Baumgartner In Zeiten zunehmender Polarisierung versucht sich die „politische Mitte“ mit teils untauglichen Mitteln von den „Randgruppen“ abzugrenzen und als im Zentrum stehend darzustellen. Eine Strategie die, wie man vielerorts sieht, keinen Erfolg hat. Die Bürger empfinden „die Mitte“ eher als Spießrutenlauf, wo sie gerade mittelalterlichen Strafen ausgesetzt, dem sicheren Untergang entgegen gehen….