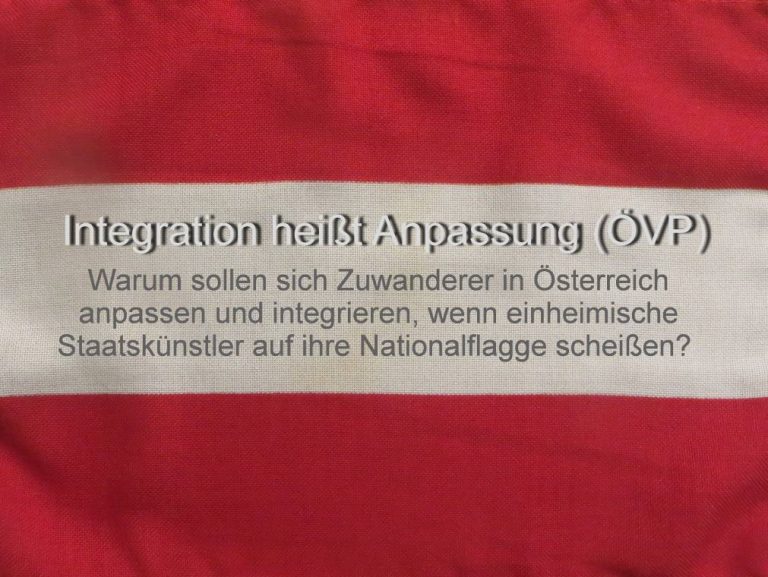Lust auf Vorstadt
Text: Peter Baumgartner

Die Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) hat 2019 eine Fachempfehlung zur Stärkung von Orts- und Stadtkernen veröffentlicht, die auf eine „Erleuchtung“ im Jahre 2011 zurückreicht. Es hat also etwas gedauert. Immerhin, dass die Attraktivität der Orts- und Stadtkerne als Wohn-, Wirtschafts- und Nahversorgungszentren schwindet und „scheinbar“ unaufhaltsam ist, wurde schon „geschnallt“. Das führte aber getreu der bisherigen Arbeitsgeschwindigkeit noch nicht zu konkreten Umlenkungen oder gar Zeitplänen, sondern zuerst nur zu „Fachempfehlungen“. Damit war der Misserfolg, den wir 2024 vielerorts noch immer sehen, vorprogrammiert: Ausgestorbene Stadtkerne und zubetonierte Vorstädte. Probleme kann man bekanntlich nicht mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind (Einstein). In Österreich versucht man es trotzdem.
Oberstes Ziel der Raumordnung NEU ist deshalb seit geraumer Zeit „Die Stärkung und Belebung der Orts- und Stadtkerne“, um den Erhalt der Lebensqualität für die Wohnbevölkerung zu sichern. In vielen Gemeinden ist das auch eine der Grundlagen für den Tourismus. Dafür braucht es, so die Experten, eine Verschränkung von Wohnen, Nahversorgung, Wirtschaft, sozialen Einrichtungen und öffentlichen Freiräumen. Nur, inzwischen hat man sich alle Mühe gegeben, um eben das nachhaltig zu zerstören. Bis jetzt hat auch niemand ernsthaft vorgeschlagen, das Shopping-Center in der Vorstadt wieder niederzureißen. Vielleicht ist ja nur der Segregationswille etwas außer Kontrolle geraten. Die Suburbanisierung eine bewusst herbeigeführte Entwicklung, die wohl von der Mehrheitsgesellschaft mehr oder weniger freiwillig getroffen wurde und somit nicht x-beliebig änderbar ist. Zumindest nicht dann, wenn man davon ausgeht, dass es keine autoritäre Suburbanisierung war und eine örtliche Raumplanung nicht nach jeder Wahl mutwillig geändert wird. Möglicherweise entsteht eine Suburbanisierung auch dadurch, dass bestimmte Betriebe exkludiert werden, damit die Kernstruktur in eine gewünschte Richtung gelenkt wird. Sichtbar wird das insbesondere dort, wo eine soziale Exklusion stattfindet. Ist der „Ruaß“ (Kohlenstaub) an die Peripherie gedrängt, kann man ungestört im Gastgarten den Caffè Latte schlürfen. Blöd wird es nur, wenn man die Zentralität so weit ausreizt, dass man am Laufsteg der Eitelkeit keinen Caffè Latte mehr bekommt.

Egal aus welchen Gründen auch immer der Ortskern/Stadtkern „gesäubert“ wurde, es besteht zunächst kein Grund, die Vorstadt genau deshalb als „Glasscherbenviertel“ abzuwerten – vorausgesetzt die neue Bausubstanz ist menschlich. Im Gegenteil. Schon seit dem Mittelalter heißt es, „Bürger und Bauer trennt nur eine Mauer“ (normalerweise). Außerdem, einhergehend mit der zunehmenden Luftverschmutzung, macht Stadtluft schon lange nicht mehr frei. Vielleicht wird auch genau dann, wenn die Peripherie stärker frequentiert wird sichtbar, dass gewisse Immobilien in der Vorstadt unbemerkt und „unter der Hand“ ihre Besitzverhältnisse gewechselt haben. Bei größeren Städten, wo sich der Stadtkern entvölkert, weil das Siedlungsgebiet wächst, entstehen mehr oder weniger eigenständige Kulturräume in Zwischenstädten und in Abhängigkeit von der übergeordneten Stadtpolitik, müssen sich deshalb nicht zwangsläufig Parallelgesellschaften entwickeln. Es sei denn, Immobilienentwickler haben für sich die Überbauung von „Brownfield“-Flächen entdeckt. Ein Geschäftsmodell, dass sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Hat doch fast jedes Dorf eine „Leiche“ im Keller. Ist das nicht der Fall, könnte es sich lohnen, statt nur zu jammern und zwanghaft nach einer Innenstadtbelebung zu streben, das Gesamtbild einer Stadt zu sehen und auch für sich zu nützen. Stadtpolitik soll nicht nur für die „Innenstadt“ werben, sondern auch „Lust auf Vorstadt“ wecken. „Lust auf Vorstadt“, oder wie der US-Soziologe Robert Ezra Park sagte: „nosing around“. In der ganzen Stadt „herumschnüffeln“, könnte für Touristen und Einheimische gleichermaßen ganz neue Erfahrungen bringen. Auf diese Art stößt man vielleicht auf architektonische Diamanten, an deren Anblick man sich selbst dann erfreuen kann, wenn man selber (leider) nicht der Besitzer ist. Das Empfinden, „unser Schloss oder „unsere Burg“ muss noch keinen Besitzanspruch abbilden.

2020 hat Roberta Rio ihr Buch mit dem Titel „Der Topophilia Effekt“ veröffentlicht. Darin erzählt die Historikerin auf wissenschaftlicher Basis, wie Orte oder Gebäude auf uns (ein)wirken können. Durch ihre Geographie, durch ihre Architektur und sogar durch ihre Geschichte. Rio weiß die Geschichte eines Ortes zu verstehen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Ob die vermeintliche Liebe zu einem Ort Glück, Wohlstand, Hass, Krankheit oder gar den Tod bringt, kann tatsächlich eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Es kommt allerdings darauf an, ob man die notwendige Sensibilität hat, die Zeichen zu erkennen und bereit ist, seinen Gefühlen zu vertrauen. Eigenschaften, die bei den Menschen leider zunehmend verschüttet werden. Dabei ist es für lebenslange Entscheidungen – und die Wahl der Ansiedlung ist oft eine solche, von größter Bedeutung, das Richtige zu tun. Für die Raumordnung ist das eine besondere Herausforderung und vielleicht wird sie von ihrem Personal genau deshalb nicht beachtet. Stattdessen wird weiter verbissen um die „Innenstadt“ gekämpft und viel Geld in „Projekte“ investiert. Möglicherweise werden so „Orte zum Verlieben“ mit einem Supermarkt verpflastert und ein Wohnsilo genau dort gebaut, wo deren Bewohner sicher nie glücklich werden können. Die Lust, den Genius loci eines Ortes zu ergründen, ist für jeden Menschen – auch für Raumplaner, entscheidend. Davon steht in den Empfehlungen der ÖROK leider keine Silbe. Vielleicht gelingt es gerade in einer Zeit, in der Menschen zunehmend die Orientierung verlieren, durch eine interdisziplinäre Raumordnung Orte zu schaffen, wo alle Menschen (und auch Tiere) wenigstens nicht krank werden. Derweil gilt noch immer: „Die Reichen wohnen, wo sie wollen. Die Armen wohnen, wo sie müssen“ (Hartmut Häußermann). Statt nur auf die „Innenstadt“, sollte man sich endlich um die Gesamtsicht kümmern.