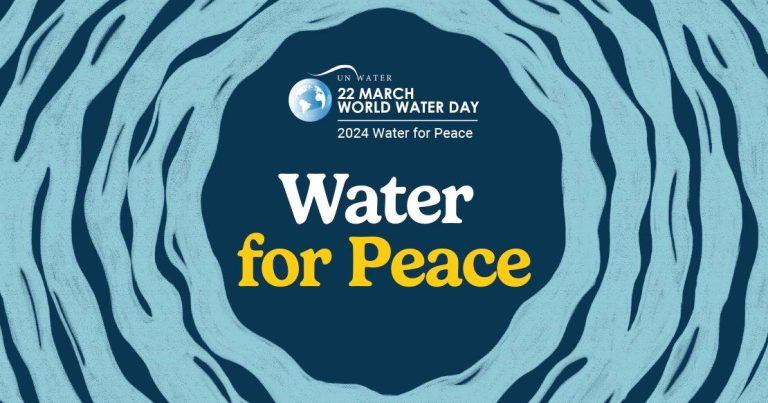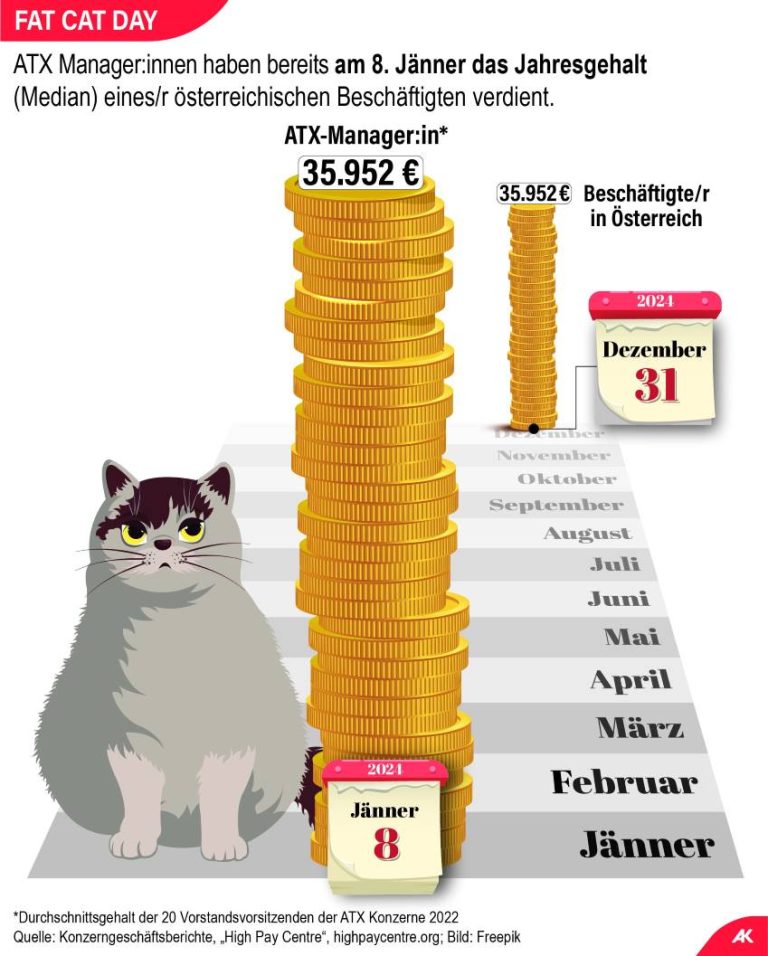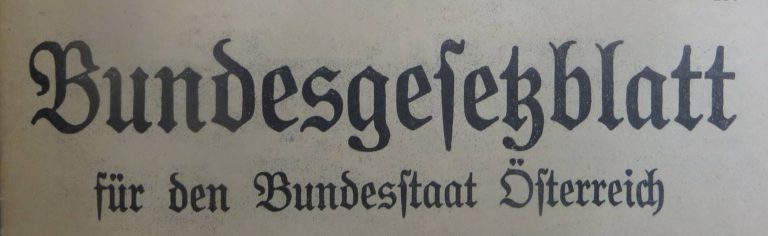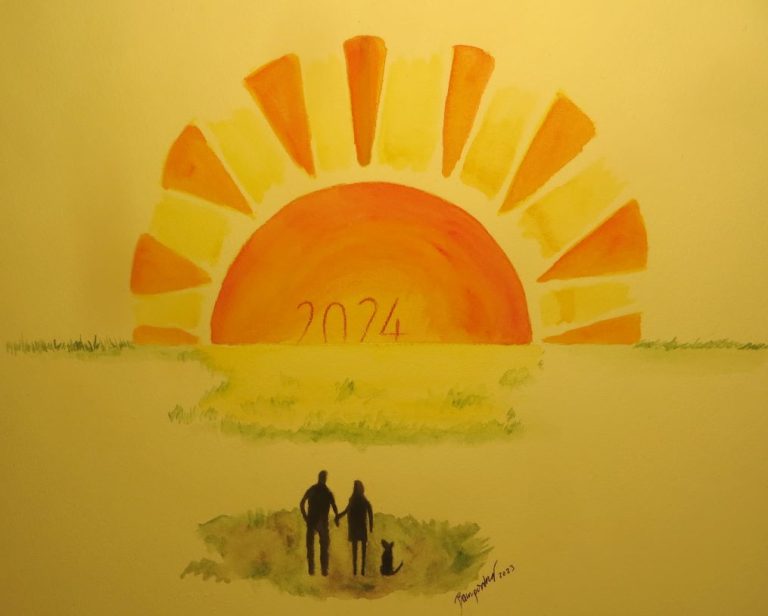WELTWASSERTAG 2024, 22. März
Text: Peter Baumgartner 2030 ist für Österreich im globalen Einklang ein besonderes Datum. Bis dahin müssen teils existentielle Ziele erreicht werden. Hinsichtlich Weltklima und anderen „Baustellen“, drängt die Zeit und vielfacht wird schon eingestanden, wir werden die selbst gesteckten Ziele nicht erreichen. Aber, wir kommen „Soylent Green“ garantiert wieder ein Stück näher. Es ist wie…